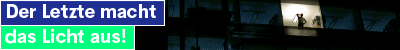Verbündete statt Rivalen
Nicht der Wettbewerb zwischen grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB) und wettbewerblichen Messstellenbetreibern (wMSB) entscheidet über die Zukunft des Messstellenbetriebs, sondern die Fähigkeit zur Kooperation. Steigende Regulierungslasten, komplexe IT-Anforderungen und Kostendruck treiben vor allem kleine und mittlere MSB an die Grenzen – und öffnen den Markt für arbeitsteilige Modelle mit spezialisierten wMSB-Dienstleistern. Warum die bisherige Frontstellung bröckeln und aus Rivalen Verbündete werden könnten, erläutert unser Autor Gerhard Großjohann. Ein Kommentar
Grundzuständige Messstellenbetreiber und wettbewerbliche Messstellenbetreiber stehen im deutschen Energiemarkt in Konkurrenz zueinander. Jedenfalls hat der Gesetzgeber die Rollen antagonistisch angelegt, und so werden sie im Markt auch gelebt. Doch bleibt das so? In einem Hintergrundgespräch hat ein Branchenexperte, der nicht genannt werden möchte, ein Szenario skizziert, das ganz anders aussieht und alsbald Realität werden könnte: gMSB und wMSB arbeiten dabei Hand in Hand und unterstützen sich gegenseitig. Warum es so kommen könnte? Hier der Gedankengang:
Messstellenbetrieb unter Regulierungsdruck
gMSB und wMSB bläst im deutschen Energiemarkt ein zunehmend rauer Wind ins Gesicht. Die Liste der Herausforderungen wird lang und länger: Immer wieder prasseln neue und noch komplexere regulatorische Anforderungen auf sie ein. Daraus resultieren ständige Anpassungen der IT-Systeme und Prozesse – was dazu führt, dass die Kosten im Messstellenbetrieb aus dem Ruder laufen.
Die große aktuell anstehende Herausforderung, die durch die Energiewende stark belasteten Niederspannungsnetze zu digitalisieren und damit flexibilisieren, droht besonders für kleine und mittelständische MSB (KMU-MSB) zum Kipppunkt zu werden. Anders als großen Unternehmen fehlt es ihnen an Ressourcen und Know-how, um die Prozesse gemäß verlangten Standards und Fristen ins Laufen zu bringen und am Laufen zu halten.
BNetzA, Fristen, Pflichten: Risiko steigt
Zudem müssen KMU-MSB neuerdings verstärkt fürchten, ins Visier der Bundesnetzagentur (BNetzA) zu geraten. Schaffen sie es zum Beispiel nicht, kurzzyklisch hochgranulare und korrekte Messwerte aus intelligenten Messsystem für das Bilanzkreismanagement automatisiert an die übergeordneten Netzbetreiber zu schicken, haben letztgenannte die Pflicht, Versäumnisse bei der BNetzA aktenkundig zu machen.
Abgesehen davon, dass KMU-MSB es aus eigener Kraft nicht schaffen, erforderliche Clearing-Prozesse anzustoßen, haben die übergeordneten Netzbetreiber meist auch wenig Interesse, bei der Fehlersuche und -behebung besonders kooperativ zu agieren. Große MSB und insbesondere Auffangmessstellenbetreiber würden profitieren, wenn KMU-MSB scheitern und ihren Messstellenbetrieb aufgeben und abtreten müssten.
Beispiel Enpal: B2B-Angebote im MSB
Beistand in dieser kritischen Lage winkt KMU-MSB von unerwarteter Seite: Heute gibt es am Markt mehrere Unternehmen, die in die Marktrolle des wettbewerblichen Messstellenbetriebs geschlüpft sind und diese erfolgreich bekleiden – allerdings zum ursprünglichen Zweck, ihr eigentliches Geschäft, den Vertrieb und das Management on PV-Anlagen, Wärmepumpen und Wallboxen, operativ zum Erfolg zu führen. Diese wMSB weisen mittlerweile respektable Einbauzahlen bei intelligenten Messsystemen (iMSys) vor. Vor allem aber haben sie es dank Hartnäckigkeit und Ausdauer geschafft, mit den großen Netzbetreibern die Datenaustauschprozesse beim Einbau und Betrieb intelligenter Messsysteme glattzuziehen und zu automatisieren. Für diese Dienstleister liegt die Idee nahe, das gewonnene Know-how auch Dritten an, sprich Stadtwerken und anderen Marktakteuren in der gMSB- und wMSB-Rolle anzubieten.
Prominentes Beispiel ist Enpal, das seinen Messstellenbetrieb ausgegliedert hat und einschlägige Dienstleistungen unter separater Flagge im B2B-Umfeld vermarktet. Das Unternehmen arbeitet dabei mit einem Smart-Metering-Dienstleister zusammen, der unter anderem das Backend-System für Gateway-Administration und Meter Data Management zur Verfügung stellt. Andere wMSB bieten vergleichbare Services in ähnlicher Konstellation an.
Steuern und Schalten: neu gedacht
Der Charme dieser Dienstleistungsoption: Kleine MSB können aus einem Portfolio verschiedener Leistungsmodule punktgenau Funktionen auswählen und per Business Process Outsourcing (BPO) in Anspruch nehmen, wo der Schuh am meisten drückt – etwa beim vielfach neuralgischen Datenmanagement im Zusammenspiel mit Netzbetreibern, aber auch beim Thema Steuern und Schalten. KMU-MSB bleiben dabei Herr ihres Handelns und erhalten ihre Eigenständigkeit, weil ein befähigter Dienstleister ihnen nur die kritischen Prozesse abnimmt und nicht nach der Übernahme des gesamten Ladens trachtet.
Fazit
Kurzum: Es gibt durchaus Möglichkeiten für kleine gMSB und wMSB, der Gefahr des Aus-dem-Markt-gedrängt-werdens zu trotzen. Der Schlüssel dafür ist intelligente Kooperation und Aufgabenteilung mit spezialisierten Playern im Energiemarkt.
Auf der Abstraktionsebene bleibt festzuhalten: In der Krise verschwinden Denkverbote und Scheuklappen. Wer gestern Wettbewerber war, kann heute Verbündeter sein. Damit könnte sich auch die Schlachtanordnung verändern: Statt wMSB gegen gMSB heißt es nun womöglich KMU-MSB gemeinsam gegen Regulierungsstress und die Branchenriesen.
Mit energie.blog auf dem Laufenden bleiben:
Über Gerhard Großjohann
Author's Box