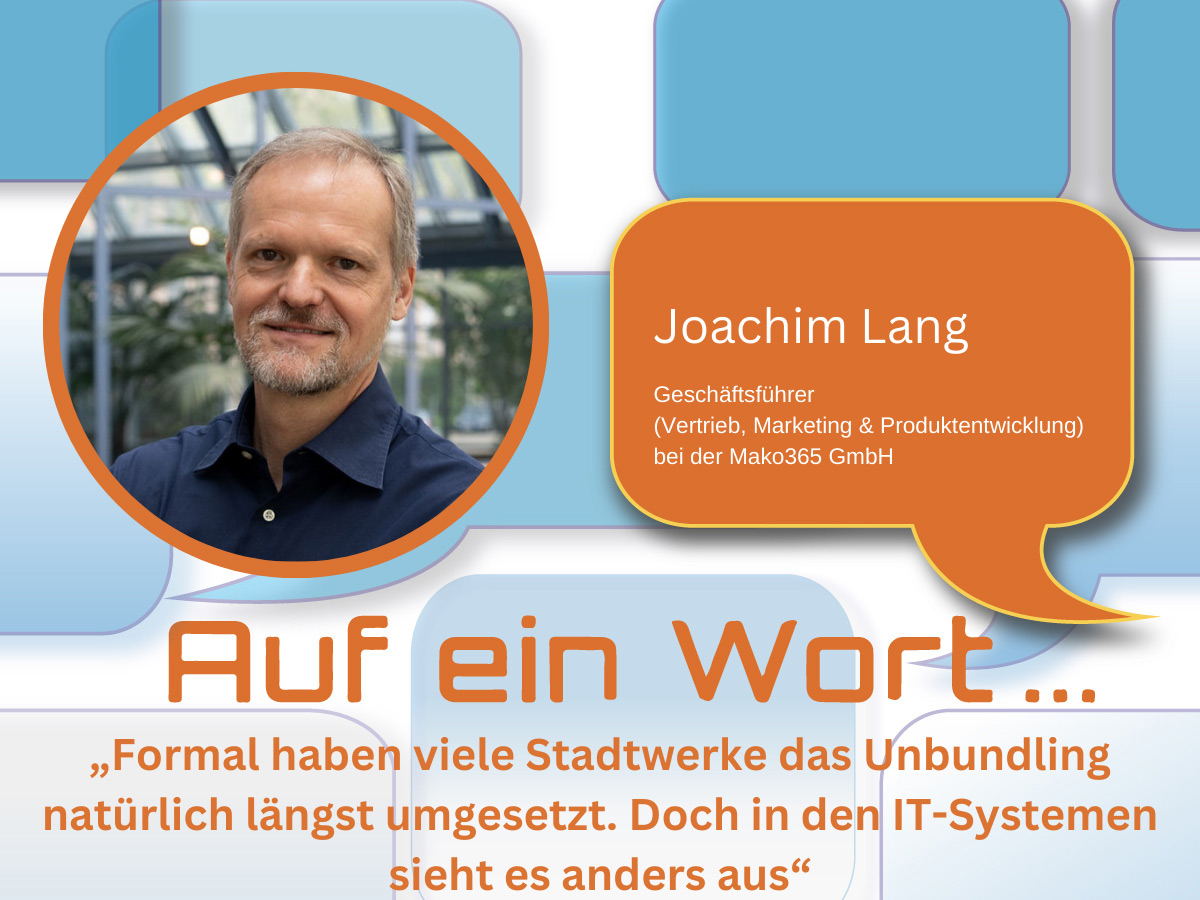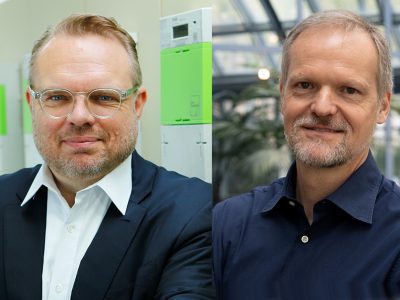„Entscheidend ist, die IT-Systeme wirklich rollenrein zu gestalten“
Joachim Lang, Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung bei Mako365, sieht viele Stadtwerke in einer kritischen Zwischenlage. Zwar sei das Unbundling formal längst umgesetzt, doch in den IT-Systemen arbeiteten Netz- und Messstellenbetrieb oft weiterhin auf denselben Plattformen. Das birgt rechtliche Risiken, erschwert Prozesse und hemmt Innovation. Im Interview mit energie.blog erklärt Lang, warum besonders der grundzuständige Messstellenbetrieb unter den alten Strukturen leidet, welche Gefahren für Datenhoheit und Sicherheit bestehen und wie klare IT-Trennungen über moderne Schnittstellen den Weg zu mehr Effizienz und Zukunftsfähigkeit ebnen können.
Unbundling bei Stadtwerken – zwischen Anspruch und Wirklichkeit
e.b: Herr Lang, Sie sprechen vom „Unbundling“ als zentralem Prinzip im Energiemarkt. Können Sie noch einmal erläutern, worum es dabei geht und warum es so wichtig ist?
Joachim Lang: Das Unbundling bedeutet die klare Trennung von Netzbetrieb und anderen Marktrollen wie Vertrieb oder Messstellenbetrieb – häufig kommt das bei Stadtwerken zum Tragen, wo diese definierten Marktrollen von einer einzelnen Gesellschaft ausgeübt werden bzw. wurden. Seit den Reformen im Energiewirtschaftsgesetz und dem Messstellenbetriebsgesetz ist festgelegt, dass diese Rollen nicht nur organisatorisch, sondern auch prozessual und informationstechnisch voneinander abzugrenzen sind. Damit sollte der Energiemarkt fairer, transparenter und wettbewerbsfähiger gemacht werden.
e.b: Die rechtlichen Vorgaben gelten schon seit Jahren. Warum ist das Thema trotzdem noch nicht abgeschlossen?
Joachim Lang: Formal haben viele Stadtwerke die Trennung natürlich längst umgesetzt, zum Beispiel durch eigenständige Gesellschaften oder separate Bilanzen. Doch in den IT-Systemen sieht es anders aus: Hier arbeiten die Gesellschaften oder, man kann fast sagen, Abteilungen von Netzbetrieb und Messstellenbetrieb häufig auf denselben Plattformen. Sie nutzen dieselben Datenbanken und teilweise sogar identische Zugriffsrechte. Damit bleibt die Entflechtung unvollständig.
Bedeutung für Verteil- und Messstellenbetreiber
„Zwar sollte der MSB laut Gesetz frei über seine Systemlandschaft entscheiden können – faktisch hängt er aber oft am Netzbetreiber, mit dem er organisatorisch und technisch eng verflochten ist.“
e.b: Was bedeutet das für den Alltag bei Verteilnetzbetreibern und Messstellenbetreibern?
Joachim Lang: Die Einschränkungen entstehen in erster Linie im Bereich des grundzuständigen Messstellenbetriebs innerhalb der Stadtwerke. Zwar sollte der MSB laut Gesetz frei über seine Systemlandschaft entscheiden können – faktisch hängt er aber oft am Netzbetreiber, mit dem er organisatorisch und technisch eng verflochten ist. Das liegt auch daran, dass viele Stadtwerke sich historisch stärker auf die Lieferantenrolle konzentriert haben: Die war früher da, strategisch wichtiger und technisch einfacher zu gestalten.
Der Messstellenbetrieb wurde erst mit dem MSbG 2016 richtig relevant und muss sich heute oft an bestehende IT-Strukturen und Prozesse anpassen, die primär für den Lieferantenbetrieb gedacht sind. Das führt immer wieder zu Reibungen – etwa bei Wechselprozessen, Geräteeinbauten oder in der Zusammenarbeit mit wettbewerblichen Messstellenbetreibern.
Risiken auf mehreren Ebenen
e.b: Welche Risiken ergeben sich aus dieser Situation?
Joachim Lang: Es gibt mehrere Ebenen. Erstens rechtlich: Wer IT-seitig nicht sauber trennt, verstößt potenziell gegen die gesetzlichen Vorgaben. Zweitens organisatorisch: Schnittstellenprobleme und unklare Datenflüsse sorgen für Verzögerungen und höheren Aufwand. Drittens sicherheitsrelevant: Es besteht die Gefahr, dass Netzbetreiber Zugriff auf sensible Messdaten haben, was Interessenkonflikte oder sogar Manipulationen begünstigen könnte.
e.b: Besonders der Messstellenbetrieb ist durch das MsbG stärker in den Fokus gerückt. Welche Folgen hat das für diese Rolle?
Joachim Lang: Der Messstellenbetreiber hat neue Aufgaben übernommen, etwa bei der Einführung intelligenter Messsysteme oder der Sicherstellung zunehmend komplexer Marktprozesse. Dafür bräuchte er flexible, spezialisierte IT-Lösungen. Doch in der Praxis ist er in alten Strukturen gefangen – buchstäblich in der IT-Struktur, aber auch allgemeiner gefasst in der gesamten Organisationsstruktur der Abteilungen. Das hemmt Innovation und erschwert die Digitalisierung.
Lösungswege aus der Situation
„Die gewachsenen Strukturen sind komplex und Investitionen erheblich. Aber ein „Weiter so“ wird den regulatorischen Anforderungen nicht gerecht und schafft dauerhafte Risiken, zum Beispiel im Sicherheitsbereich.“
e.b: Wie könnte man das Problem lösen?
Joachim Lang: Entscheidend ist, die IT-Systeme wirklich rollenrein zu gestalten. Das heißt: klare Mandantengrenzen, getrennte Datenhaltung und eigenständige Berechtigungen. Moderne Plattformen können per API angebunden werden, ohne dass bestehende ERP-Systeme komplett ausgetauscht werden müssen. So lassen sich die regulatorischen Anforderungen erfüllen, ohne die gesamte Systemlandschaft zu gefährden. Am Rande bemerkt: Wir haben mit unserer Software MakoFlow genau so ein System im Angebot, das schlank und flexibel die MSB-Funktionalitäten abdecken kann.
e.b: Viele Stadtwerke scheuen vor einer kompletten Neuaufstellung zurück. Haben Sie Verständnis dafür?
Joachim Lang: Absolut. Die gewachsenen Strukturen sind komplex und Investitionen erheblich. Aber ein „Weiter so“ wird den regulatorischen Anforderungen nicht gerecht und schafft dauerhafte Risiken, zum Beispiel im Sicherheitsbereich. Dazu kommen die genannten Probleme in den Prozessen, die viel Arbeitskraft binden, weil Dinge einzeln und händisch gelöst werden müssen. Das ist ineffizient und auch für die Mitarbeitenden unbefriedigend.
Wünsche an die Regulierung
e.b: Was wünschen Sie sich von der Regulierung?
Joachim Lang: Klare Leitplanken und Vorgaben, die die IT-seitige Entflechtung verbindlich machen. Solange es erlaubt bleibt, hybride Ausschreibungen über Netz- und MSB-Funktionen gemeinsam zu vergeben, wird sich wenig ändern. Wir hatten kürzlich einen Fall, wo uns auf Nachfrage sinngemäß mitgeteilt wurde, die Kombination von Netz- und Messstellenbetrieb sei in der Praxis der EVU eben häufig gebündelt. Solch eine marktrollenübergreifende Ausschreibung dürfte es eigentlich gar nicht geben.
e.b: Ihr Fazit für Stadtwerke?
Joachim Lang: Wer heute noch mit stark verflochtenen IT-Landschaften arbeitet, sollte handeln. Nicht nur, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, sondern auch, um in einem zunehmend datengetriebenen Energiemarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Stadtwerke sollten die Entflechtung nicht nur als gesetzliche Pflicht sehen, sondern als Chance, ihre Organisation neu aufzustellen – klar getrennt, digital anschlussfähig und damit auch strategisch zukunftssicher.